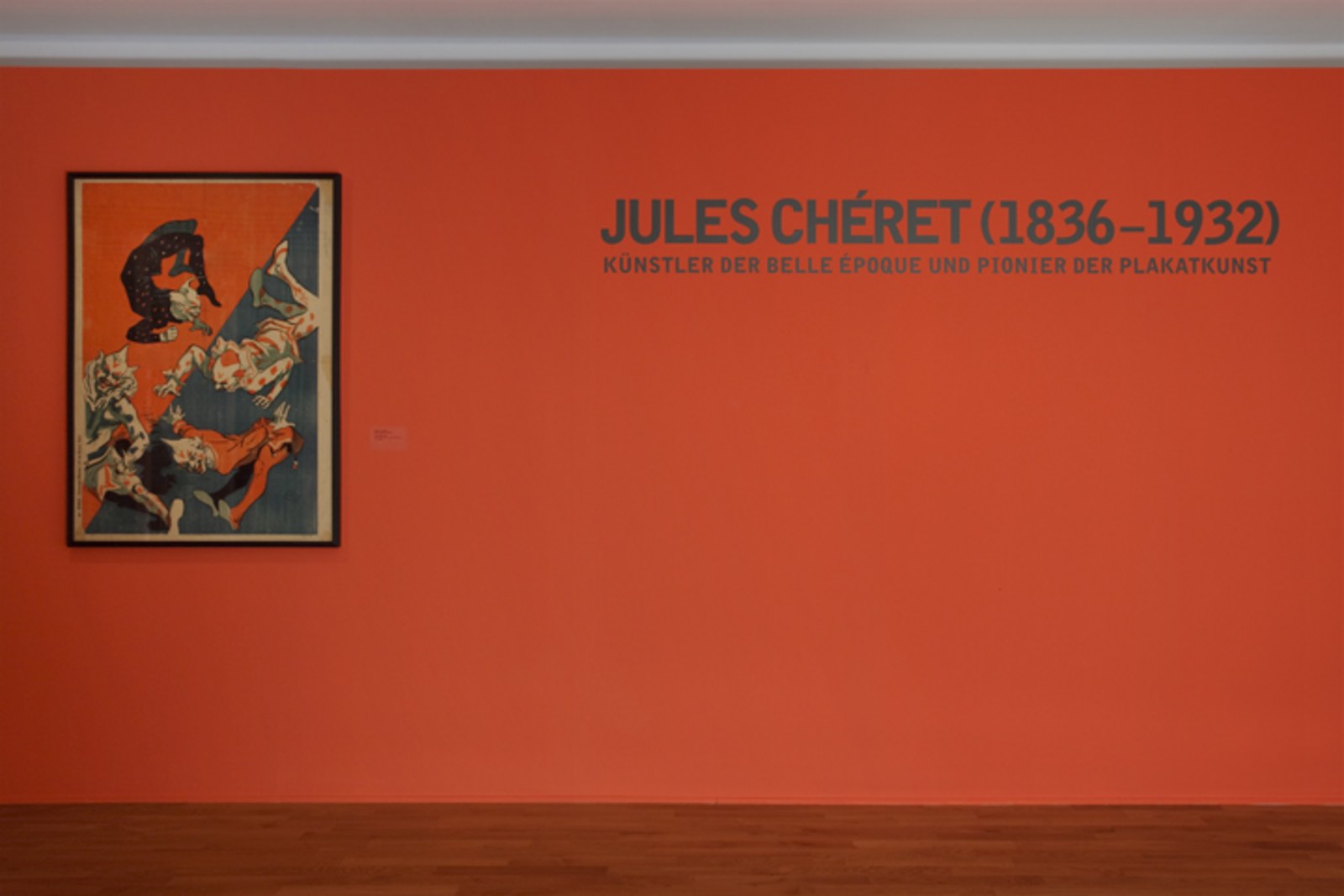Mit großzügiger Unterstützung des Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, Nizza
Jules Chéret (1836–1932) gilt als der Vater des modernen Plakats. Als Lithograf, Drucker, Zeichner, Maler, Dekorateur und Illustrator ist er eine herausragende Gestalt des Pariser Künstler- und Literatenmilieus an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Unter Einsatz der Farblithografie entwickelte Chéret das Werbeplakat zu einer eigenständigen Kunstform und trug mit seiner gewaltigen Produktion von Farbplakaten zum Wandel des städtischen Erscheinungsbildes der Kunstmetropole Paris bei. Die Liberalisierung der Presse, die Erweiterung des Schienennetzes und der Aufschwung von Wirtschaft und Handel führten gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einer großen Nachfrage nach Plakaten und Illustrationen. Jules Chéret widmete sein Motivspektrum sämtlichen Bereichen des Wirtschaftslebens, vom Zirkus und Caféhaus-Konzert über Ausstellungen bis hin zu Konfektionsmode und Kosmetika, Arzneimitteln und Presseerzeugnissen. Seine außergewöhnlichen Plakatentwürfe verschafften ihm den Spitznamen »Tiepolo der Boulevards«.
Diese Chéret gewidmete Retrospektive konzentriert sich auf sein Werk als Plakatkünstler, beleuchtet aber auch seine weniger bekannte Seite als Zeichner, Maler und Dekorateur. Sie befasst sich mit der Frage von Chérets Stil, der einerseits in der Tradition des Neorokoko steht und darüber hinaus aus Quellen wie dem Japonismus schöpft, andererseits aber auch erste Elemente der Moderne aufweist, die später Impressionisten wie beispielsweise Georges Seurat oder Henri de Toulouse-Lautrec faszinieren sollten. Anhand einer umfangreichen Auswahl aus seinem Gesamtwerk wird die Laufbahn dieses für die Geschichte der Plakatkunst wegweisenden und bedeutenden Künstlers nachgezeichnet. Möbel, gemalte Dekorelemente, Wandgrafiken, Kartons für Wandbehänge, Porträts und Zeichnungen finden sich ebenso in der Ausstellung wie Theaterund Zirkusplakate, Reklameposter, Buchumschläge, Werbekarten und -programme, insgesamt etwa 240 Objekte.
Zur Ausstellung
Bereits während seiner frühen Jahre, aus denen vorwiegend kleinere Arbeiten wie Briefköpfe, Vignetten, Musikpartituren und Buchillustrationen in romantischer Tradition überliefert sind, ahnte der von 1849 bis 1852 in Paris zum Lithografen ausgebildete Chéret, dass die in England zu jener Zeit bereits für die industrielle Fertigung von Plakaten eingesetzte Farblithografie Anwendungsmöglichkeiten bieten würde, die in Frankreich noch nicht richtig genutzt wurden. Nachdem sich aus seinem ersten prominenten Plakatauftrag für die Ankündigung der Oper »Orpheus in der Unterwelt« von Jacques Offenbach in seiner Heimat keine weiteren Entwicklungsperspektiven ergaben, ließ er sich 1859 in London nieder. Dort schulte er seinen Blick an den Werken Gainsboroughs und Turners, vor allem aber entdeckte er dort das farbige Wandplakat, darunter das Zirkusplakat, das zu einer seiner Spezialitäten werden sollte. Seine Begegnung mit dem Parfümeur Eugène Rimmel, für den er dessen »Livre des parfums« sowie zahlreiche Etiketten und Aufkleber für Kosmetika gestaltete, war der Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Im Jahr 1866 kehrte Jules Chéret nach Paris zurück und eröffnete mit Hilfe eines ihm von Rimmel zur Verfügung gestellten Darlehens eine eigene Lithografie-Anstalt. Bereits sein erstes Plakat »La Vie parisienne«, das für Offenbachs Operette »Pariser Leben« warb, wurde zum Erfolg und markierte den Beginn einer langen und intensiven Schaffensphase, in der in rund 40 Jahren annähernd 1200 Plakate entstehen sollten.
Voraussetzung für seine Karriere als Erfinder des modernen Plakats waren die aus England importierten technischen Neuerungen der Lithografietechnik, einer ursprünglich bayerischen Erfindung, sowie die Vereinfachung des Druckverfahrens. Als Meister der Farbgebung trennte Chéret die einzelnen Farbnuancen von den Lithografiesteinen und reduzierte somit deren Anzahl. Das Endprodukt entstand, indem Chéret Steine nach- und übereinander abdruckte. Das Druckverfahren wurde somit kostengünstiger, aber auch ein neuer Darstellungsstil entstand. An die Stelle des eher malerischen Duktus der früheren Vielfarbdrucke trat nun eine verstärkt flächige und somit stilisierte Darstellung. Mit zunehmendem Publikumserfolg trat Chéret 1881 seine Druckerei an den Drucker Chaix ab, behielt aber vorerst deren künstlerische Leitung. Auch weiterhin illustrierte er Bücher, Zeitschriften, Speisekarten und nahm mit seinen Ausstellungen am kulturellen Leben teil. Sehr rasch erkannte die Kritik in ihm einen Neuerer, nicht nur weil er eine neue Kunstform etablierte, sondern weil er, so Joris-Karl Huysman anlässlich des Salons von 1879, einer in einem sterilen Konformismus »trauriger Dinge« erstarrten Malerei frisches Leben einhauchte. Er repräsentierte eine lebendige, sich an jedermann gleichermaßen richtende Kunst. Seine lebhafte Art der Zeichnung, seine dynamischen und rhythmischen Kompositionen, seine Bildformate und seine hellen, leuchtenden Farben wurden zum Vorbild einer neuen Plakatkunst, die die Vorstellungswelt der Belle Époque spiegelte, gleichzeitig aber bereits Züge der farblichen Abstraktion in sich trug. Chéret erfand bestimmte charakteristische Figuren wie den Typus der fröhlichen, frivolen Pariserin, die in eleganter Pose oft lebensgroß auf seinen Plakaten erscheint und, in Anlehnung an ihren Schöpfer, allgemein als »Chérette« bekannt wurde. Eine weitere, immer wiederkehrende Figur in Chérets Werk ist der Clown, dessen Körper er in einem Spiel der Windungen und Gegenwindungen fortlaufend weiterentwickelte.
Unter dem Einfluss von Kritik und Grafikliebhabern wurde das Plakat schnell zum Sammelobjekt. Es entstand ein neuer Trend, die »Affichomanie«, das leidenschaftliche Sammeln von Plakaten. Chéret war die zentrale Figur dieser sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts beständig weiter verbreitenden Begeisterung für das neue Bildplakat. Auch seine Druckgrafiken waren sehr gefragt, Ausstellungen und Sonderausgaben von Zeitschriften wurden ihm gewidmet. Er war in allen Ausstellungen vertreten und gehörte sämtlichen Künstlerzirkeln an – jenen auf dem Montmartre ebenso wie dem der Impressionisten, deren Wände seine Plakate zierten. Außerdem stand er mit einem beeindruckenden Kreis von Künstlern, Kritikern, Schriftstellern und Sammlern in Verbindung. Claude Monet, Edgar Dégas, Georges Seurat, August Rodin, Théophile Steinlen und Jacques Villon zählten zu seinen Freunden. Die Wirkung seiner Plakate beschränkte sich nicht auf den kommerziellen Bereich, sondern durchdrang mehr und mehr auch die Sphäre der Kultur. Auf den Weltausstellungen von 1878 und 1889 gewann Chéret für seine Arbeiten eine Gold- und eine Silbermedaille. Im Jahr 1889 wurde er anlässlich einer Plakatausstellung im Rahmen der Weltausstellung zum »König des Plakats« gekürt und das Plakat offiziell als Kunstform anerkannt. Eine im selben Jahr im Théatre d'Application la Bodinière organisierte Ausstellung zeigte Chéret als Zeichner und Pastellmaler und trug damit zur wachsenden Anerkennung dieser Seite seines künstlerischen Schaffens bei, die in den folgenden Jahren mehr und mehr in den Vordergrund trat.
Ab den 1890er Jahren wandte sich Chéret auch der Innenausstattung zu und fertigte Entwürfe für die Villa »La Sapinière« von Baron Vitta in Evian (1893–94), für das Pariser Rathaus (1895), die Villa seines zweiten wichtigen Mäzens Maurice Fenaille (1896), den Bühnenvorhang des Theaters im Musée Grévin (1900) sowie zwei Gemälde für dieses Museum, die als Supraporten das Anwesen des Direktors schmücken sollten, für die Präfektur von Nizza (1906) und für Tapisserien der Manufacture nationale des Gobelins (1908). Auf Anregung Maurice Fenailles, Pionier der französischen Erdölindustrie, ging Chéret von der Schaffung dekorativer Tafeln zur Gestaltung von Wandbehängen über und verlieh diesem Genre damit zu Beginn des 20. Jahrhunderts neue Impulse. Fenaille beauftragte ihn mit Projekten für seine Villa in Neuilly, »gegen den Widerstand der offiziellen Künstler, die sich dagegen wehrten, dass man einem Emporkömmling in der Malkunst wie Chéret die Gobelins anvertraute«.
Auch in seiner Dekorationsmalerei und in seinen Fresken, blieb Chéret – wie auch in seinen zarten, gefälligen Ölbildern und Pastellen – seinen Themen und seiner Farbpalette treu. Zwar passte er die Technik den Gegebenheiten an, seinen Stil jedoch änderte er nicht. Die Motive und Farben seiner Plakate kehrten auch hier wieder: Die weiblichen Figuren, die zuvor für Vergnügungsstätten und verschiedenste Produkte geworben hatten, verkörperten nun seine Allegorien. Verfangen in derselben aufsteigenden »tiepolesken« Bewegung, die barocke Anleihen zeigt und die Leichtigkeit seiner Kunst ausmacht, blieben sie mit ihren leuchtenden Farben vorherrschendes Motiv in Chérets Kunst, die in ihrem Vorbildcharakter für spätere Generationen nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und der weiteren Entwicklung der Künste nachhaltig prägende Impulse verlieh.
Katalog
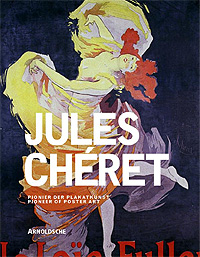
In Zusammenarbeit mit ARNOLDSCHE Art Publishers legt das Museum Villa Stuck die erste große deutschsprachige Publikation zu Jules Chéret vor. Anhand von Texten von Ségolène Le Men, Réjane Bargiel und Martijn F. Le Coultre in deutscher und englischer Sprache und mehr als 120 Farbabbildungen kann das deutsche Publikum damit zum ersten Mal auf den Pfaden dieser bedeutenden Figur des 19. Jahrhunderts wandeln. Herausgegeben von Michael Buhrs, 168 Seiten, Format 21 x 27 cm, Klappen-Broschur, Text in Deutsch und Englisch. ISBN 978-3-89790-356-2